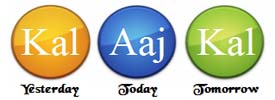Tamara Carrasco setzt sich für unabhängiges Katalonien ein. Sie wurde verhaftet und sitzt seit Monaten im Hausarrest
|
Gegen die spanische Zentralgewalt: Demonstration vor einem Abstimmungslokal während des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 in Sant Julià de Ramis
Foto: Albert Gea/REUTERS
|
jungeWelt
27-12-2018
Von Krystyna Schreiber, Barcelona
Am Morgen des 10. April 2018 wird die 35jährige Sozialarbeiterin Tamara Carrasco y García durch lautes Klopfen an der Wohnungstür geweckt. Als sie öffnet, stehen draußen ein Dutzend Beamte der spanischen paramilitärischen Guardia Civil in Tarnfarbenuniformen und mit Maschinengewehren. Sie haben einen Durchsuchungsbefehl gegen sie und einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf Rebellion, Aufruhr und Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation. Tamara ist sich keiner Schuld bewusst: »Mehr als einen Strafzettel oder einer Anzeige wegen Ungehorsam habe ich nie riskiert«, erzählt sie im Gespräch mit junge Welt in einer kleinen Bücherei im Zentrum ihres Heimatortes Viladecans, einem Städtchen unweit der katalanischen Metropole Barcelona.
Die Guardia Civil durchsucht die 70 Quadratmeter große Wohnung vier Stunden lang. Die Beamten beschlagnahmen eine gelbe Trillerpfeife, ein Plakat mit der Aufschrift »Freiheit und Demokratie«, ein Foto des inhaftierten Vorsitzenden der Kulturvereinigung Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ein kaputtes Handy sowie einen Speicherstick. Tamara steht am Fenster und hört, wie die Medien vor ihrem Haus über sie berichten. »Die Journalisten waren zur gleichen Zeit wie die Polizei da und wussten mehr Details als ich.« Wie die meisten Spanier ihres Alters ist Tamara mit den Fernsehübertragungen der Festnahmen mutmaßlicher ETA-Terroristen aufgewachsen. Als die Guardia Civil sie fragt, ob sie beim Verlassen des Hauses ihr Gesicht verdecken wolle, lehnt sie ab. Sie will nicht das von damals bekannte Bild liefern. Noch heute hat sie das Blitzlichtgewitter vor Augen, als sie über den Platz vor ihrem Haus abgeführt wird. Sie ist überzeugt, dass man ihre Festnahme für die Medien inszeniert hat.
Tamara wird nach Madrid gebracht und verbringt dort zwei Tage in einer fünf Quadrameter großen Zelle. Nach den spanischen Sonderbestimmungen bei Verfahren wegen Terrorismusverdachts darf sie keinen Anwalt sprechen. Tamara schweigt. Dennoch wird sie zum Verhör gezwungen. Der einzige Anruf, den sie machen darf, richtet sich an Freunde, nicht die Familie. Tamara ist für ein unabhängiges Katalonien, ihr Vater für die Einheit Spaniens. Oft kracht es deshalb bei Familienfeiern. Zurück in ihrer Zelle sagt sich Tamara immer wieder: »Ich habe nichts Schlechtes getan, ich bin eine starke Frau.« In dem Moment hat sie Angst. »Nur jemand, der in so einer Zelle eingeschlossen ist, kann das nachvollziehen.«
Fingierte Anklage
Am dritten Tag wird sie in Handschellen dem Richter der Audiencia Nacional, einem Sondergericht für besonders schwere Straftaten, vorgeführt. Dort trifft sie ihren Anwalt, den die Eltern organisiert haben. Vor Gericht beantwortet sie nur seine Fragen. Als der Staatsanwalt die Anschuldigungen verliest, erkennt sich Tamara nicht wieder. Sie habe einen Anschlag auf die Kaserne der Guardia Civil in Barcelona geplant. Später stellt sich heraus, dass sich der Vorwurf auf ein Bild von Google Maps stützt, das sie sich als Wegbeschreibung zu einer Demonstration ausgedruckt hatte. Sie wird als Koordinatorin der »Komitees zur Verteidigung der Republik« (CDR) bezeichnet, die als terroristische Organisationen dargestellt werden, und soll sich der Anstiftung zu Straftaten, zum Beispiel zur Blockade von Autobahnen am Osterwochenende, schuldig gemacht haben. »Wer etwas über die CDR weiß, kennt ihre horizontale Struktur. Es gibt keine Koordinatoren«, erklärt Tamara jW gegenüber.
Im Dokument der Staatsanwaltschaft taucht auch Adrià Carrasco auf, der am gleichen Tag wie Tamara verhaftet werden sollte, aber flüchten konnte und sich nach Belgien absetzte. »Die Guardia Civil ging wegen des gleichen Nachnamens davon aus, dass wir miteinander verwandt wären, dabei kennen wir uns gar nicht«, erzählt Tamara. Der Verteidigung platzt der Kragen. Das sei ein politischer Prozess ohne juristische Grundlage, schimpft ihr Anwalt. Der Staatsanwalt droht ihm daraufhin mit einer Klage wegen Befangenheit. Als der Schlagabtausch zwischen den Juristen aus dem Ruder läuft, beendet der Richter die Anhörung. Eine Viertelstunde danach ist Tamara gegen Auflagen auf freiem Fuß.
Erst später wird ihr bewusst, was diese Vorschriften für sie bedeuten. Tamara darf Viladecans nur verlassen, um zu ihrer Arbeitsstelle in Barcelona zu fahren, und sie muss sich wöchentlich beim Ortsgericht melden. Die Guardia Civil überwacht sie. Nach wenigen Wochen lässt sich Tamara krankschreiben, der psychologische Druck ist zu hoch. Ihre Familie und viele Freunde wohnen in anderen Orten und kommen sie besuchen. Als sich ihre Mutter ein Bein bricht und nicht zu ihrer Tochter fahren kann, beantragt Tamara, sie besuchen zu dürfen. Der Antrag wird abgelehnt.
Anfangs hat die Repression gegen Tamara auch auf die CDR einschüchternde Wirkung. Im gesamten Gebiet des Baix Llobregat, in dem Viladecans liegt, finden keine Aktionen mehr statt. Die Aktivisten haben Angst und wollen der Anklage keine Argumente gegen Tamara und Adrià liefern. »Es ist wie eine Welle, die sich nicht nur gegen dich richtet, sondern sich auf dein gesamtes Umfeld ausbreitet. Bis vor kurzem wurde ich sehr streng bewacht – und damit alle, die mich umgeben«, erklärt Tamara.
Kein Gericht zuständig
Anfang November entscheidet der Richter, dass es gegen Tamara keine Belege für Rebellion, Terrorismus und Aufruhr gibt. Dennoch wird der Hausarrest nicht aufgehoben. Anwalt Benet Salelles erläutert im Telefongespräch die absurde Situation: »Es gibt eine endgültige juristische Entscheidung. Die Audiencia Nacional sagt, dass sie nicht zuständig ist, weil sie keine Indizien für die Anschuldigungen sieht. Damit geht der Fall an die allgemeine Justiz. Das heißt, der Fall wird dem Gericht übergeben, in dessen Einzugsbereich die untersuchten Vorfälle stattgefunden haben. Aber man weiß nicht, welche Taten meiner Mandantin vorgeworfen werden.« Da ihr keine konkreten Taten zugeordnet werden konnten, schickte die Audiencia Nacional den Fall gleichzeitig an die Gerichte in vier Bezirken: Lleida, Girona, Barcelona und Tarragona. »Tamara lebt in keinem der vier, es ist der totale Unsinn«, formuliert ihr Anwalt sein Unverständnis. Es werde wahrscheinlich Monate dauern, bis sich ein Gericht für zuständig erklärt und dann eventuell den inzwischen achtmonatigen Hausarrest gegen sie aufhebt.
Ihr Anwalt glaubt, dass hinter dieser Situation eine klare Absicht steckt. »Wir kennen das Phänomen der CDR, und wir denken, dass man das Konzept des Terrorismus nicht auf sie anwenden kann. Sie sind Ausdruck des friedlichen Widerstands. Aber der Staat will ein Bild aufrechterhalten, das in den 1990er Jahren im Baskenland gewirkt hat und stellt Parallelen her, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Wenn Politiker und Juristen die CDR mit Kale borroka (gewalttätige Straßenaktionen von Anhängern der baskischen Unabhängigkeitsbewegung; jW) vergleichen, mischen sie bewusst Konzepte. Ich glaube, dass es sich hierbei um eine Operation des Staates handelt, mit der versucht wird, die Realität in Katalonien zu ändern.«
Aus Tamaras Sicht hat ihre Situation auch Positives bewirkt. Früher lagen Tochter und Vater ideologisch weit auseinander. Inzwischen zweifelt ihre Familie am System. »Mein Vater ist weiterhin für Spanien, aber er versteht jetzt, warum ich tue, was ich tue«, sagt Tamara fast stolz. Viele Bewohner ihres Orts Viladecans seien eher dafür, alles in Spanien so zu lassen, wie es ist. Doch sie erhält von allen Seiten Unterstützung. »Viele Nachbarn, die prospanisch eingestellt sind, habe mir ihre Solidarität bekundet, denn sie wissen, dass ich keiner Fliege etwas zuleide tue.«
Inzwischen würden immer mehr Menschen verstehen, dass es nicht nur um die Unabhängigkeit Kataloniens geht, sondern um die Grundrechte. »Wenn man ein Störfaktor ist, wird das Maulkorbgesetz angewendet«, kritisiert Tamara. Aus Angst zu Hause zu bleiben ist für sie aber keine Option. Sie will jetzt erst recht kämpfen: »Es ist eine Frage meiner Würde.« Und sie ist wütend. »Drei Tage lang war ich die meistgehasste Person Spaniens. Ich habe mehr als 300 Morddrohungen auf meinem Handy erhalten. Ich wurde zu einer öffentlichen Person gemacht. Adrià musste ins Exil gehen. Wir hatten keinen Gerichtsprozess, um uns verteidigen zu können.« Und sie glaubt, dass die Repression Katalonien der Unabhängigkeit möglicherweise näherbringen könnte. Das erste, was sie in einem unabhängigen Katalonien ändern würde, sei das Strafrecht. »Wenn wir eine Republik gründen, müssen wir sicherstellen, dass keinem Menschen das widerfährt, was mir passiert.«